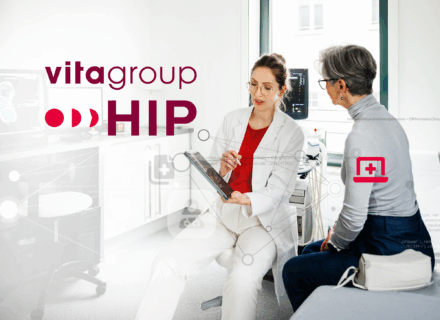Wie offene Plattformen die Forschung vorantreiben
Fragmentierte, nicht standardisierte Gesundheitsdaten erschweren die Forschung, treiben die Kosten in die Höhe und schränken die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen ein. Offene Plattformen sorgen für Struktur und Interoperabilität und ermöglichen es, Daten in großem Umfang für schnellere und wirkungsvollere medizinische Fortschritte zu nutzen.

Jeder bedeutende Fortschritt in der Gesundheitsforschung basiert auf dem Fundament gemeinsamer Erkenntnisse und Daten. Die Fragmentierung von Daten bleibt jedoch eine anhaltende Herausforderung: In Europa gehen laut dem Europäischen Forschungsraum (EFR) jährlich zwischen drei und fünf Milliarden Euro in der Forschung verloren, da Daten isoliert vorliegen und die Gesundheitssysteme nicht interoperabel funktionieren.
Wenn Daten nicht einheitlich erfasst sind
Um die Ursache dieser Herausforderungen zu erkennen, muss man verstehen, wie sich nicht interoperable Daten in der Praxis auf die Forschung auswirken. Nehmen wir als Beispiel Daten im Zusammenhang mit Diabetes. Blutzuckermessungen, einer der Parameter für Diabetesstudien, werden von den verschiedenen Gesundheitsdienstleistern oft uneinheitlich gespeichert:
- Krankenhaus A erfasst in verschiedenen Abteilungen den Blutzuckerwert mit unterschiedlichen Benennungen – beispielsweise „Blutzucker“ oder „GLUC“. Da kein einheitlicher Code oder ein einheitliches Format verwendet wird, erschwert dies die automatisierte Zusammenführung der Daten.
- Krankenhaus B verwendet ein benutzerdefiniertes Datenbankschema, in dem die Glukosewerte numerisch (z. B. 100) gespeichert werden, ohne jedoch die Einheit (mg/dL oder mmol/L) anzugeben, sodass eine manuelle Umrechnung erforderlich ist.
- Krankenhaus C verwendet codierte Daten, aber interne, nicht standardisierte Kennungen wie z. B. BG_001, die nicht mit internationalen Standards übereinstimmen.
Solche Unterschiede bei der Datenerfassung gibt es nicht nur zwischen Krankenhäusern, sondern auch innerhalb von Kliniken. Sind Daten auf so unterschiedliche Weise kodiert, funktionieren sie nur innerhalb der Datenbank eines bestimmten Krankenhauses und können von Forschenden nicht direkt für den Abgleich mit Datensätzen aus anderen Systemen oder Krankenhäusern verwendet werden. Somit stehen Forschende, die auf Blutzuckerdaten aus mehreren Krankenhäusern zugreifen und diese nutzen möchten, vor mehreren Herausforderungen:
- Sie müssen viel Zeit und Ressourcen in die Bereinigung und Standardisierung der Daten investieren, um sie kompatibel zu machen und effektiv nutzen zu können. Dieser arbeitsintensive Prozess nimmt eine Menge Zeit in Anspruch und treibt folglich die Studienkosten in die Höhe.
- Daten werden oft manuell „bereinigt“, was das Risiko von Fehlern oder Fehlinterpretationen erhöht und die Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen potenziell gefährdet.
- Für groß angelegte Gesundheitsstudien werden Daten von mehreren Institutionen oder sogar Ländern benötigt, um Trends zu erkennen, die Wirksamkeit von Behandlungen zu bewerten und neue Therapien zu entwickeln. Diskrepanzen bei der Datenerfassung in Gesundheitssystemen machen diesen Prozess langsam und komplex, verzögern die Zusammenarbeit und verringern die statistische Aussagekraft von Studien.
Ein einheitlicher Ansatz für Forschungsdaten
Damit Forschung effektiv und kosteneffizient sein kann, ist ein nahtloser Zugang zu strukturierten Daten über verschiedene Gesundheitsorganisationen und Einrichtungen hinweg erforderlich – und hier bieten offene Plattformen das entscheidende Fundament. Sie stellen sicher, dass Gesundheitsdaten unabhängig von dem System, das sie erstellt hat, strukturiert und zentral gespeichert werden und in Echtzeit verfügbar sind.
Dies bietet der Forschung mehrere Vorteile:
- Offene Plattformen machen Datenmappings überflüssig, sodass Daten einfacher und schneller kombiniert und untersucht werden können und Forschende darauf vertrauen können, dass sie vergleichbare Informationen erhalten.
- Durch die schnelle Verfügbarkeit von Daten wird auch die Forschungszeit verkürzt, was die Kosten senkt und zu schnelleren Ergebnissen und Verbesserungen im Gesundheitswesen führt.
- Fehler, die bei der manuellen Datenbereinigung auftreten, werden aufgrund der leicht verfügbaren kompatiblen Datenformate vermieden.
- Die Forschung beschränkt sich nicht auf isolierte Datensätze, sondern kann auf Plattformen, Regionen und Länder ausgeweitet werden, was größere und vielfältigere Studien ermöglicht.
- Offene Plattformen ermöglichen den Zugriff auf Daten aus der Praxis, sodass Forschende Erkenntnisse darüber gewinnen können, was tatsächlich funktioniert, anstatt sich auf kontrollierte Versuchsanordnungen zu verlassen.
Offene Plattformen im Einsatz
Als Universitätsmedizin Bochum haben die Medizinische Fakultät und das Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum (UK RUB) einen offenen Plattformansatz gewählt, um eine nahtlose Forschungszusammenarbeit zwischen den acht Trägern des UK RUB zu ermöglichen und eine zentrale Stelle für die Datenbereitstellung an die Medizininformatik-Initiative (MII) zu etablieren.
Bei ca. 800.000 PatientInnen pro Jahr wird die Forschungsinfrastruktur der Universitätsmedizin Bochum riesige Mengen klinischer, pseudonymisierter Daten in einem standardisierten, interoperablen System zusammenführen und so sicherstellen, dass Forschende der UK RUB aber auch Forschende der MII effizient Zugang zu hochwertigen Datensätzen erhalten.
Jedes Krankenhaus innerhalb der Universitätsmedizin Bochum behält die Kontrolle über sein lokales Datenmanagementsystem, während es einer zentralen Instanz pseudonymisierte Forschungsdaten bereitstellt.
Mit einem initialen Fokus auf die Basismodule des Kerndatensatzes der Medizininformatik Initiative (MII) legt das offene Plattformprojekt der Universitätsmedizin Bochum den Grundstein für groß angelegte, datengestützte Studien, die letztlich die medizinische Forschung beschleunigen und perspektivisch die Behandlungsergebnisse für die PatientInnen verbessern können.
Schnellere medizinische Forschung und bessere Behandlungsergebnisse für PatientInnen
Ähnlich wie die Universitätsmedizin Bochum entwickelt das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim eine innovative Forschungs-IT-Plattform (FIT), um die datengesteuerte Forschung in den Bereichen psychische Gesundheit und psychiatrische Störungen zu verbessern. Das Herzstück der FIT-Plattform ist die HIP der vitagroup, die Daten aus den verschiedenen IT-Systemen des Instituts zentral vereinheitlich speichert und zur Verfügung stellt, wodurch eine strukturierte Speicherung und Interoperabilität gewährleistet werden:
- ORBIS (Dedalus): Liefert strukturierte klinische Daten, einschließlich Diagnosen, Medikationen und Behandlungsprotokollen.
- REDCap: Erfasst strukturierte Forschungsdaten, wie z. B. beantwortete Fragebögen und Informationen zu klinischen Studien.
- Labordatenbanken: Liefern biochemische, genetische und diagnostische Testergebnisse, die für Studien zur psychischen Gesundheit relevant sind.
Dank der zentralen Datenspeicherung, durch die HIP, können Forschende Patientendatensätze effizient abfragen, Studienparameter definieren und auf hochwertige klinische Informationen zugreifen, ohne die Vertraulichkeit der Patientendaten zu gefährden. Die Plattform automatisiert auch das Einwilligungsmanagement und vereinfacht die Genehmigung von Forschungsanfragen.
Offene Plattformen schließen die Lücke zwischen fragmentierten Datenquellen. So kann die Gesundheitsforschung effizienter, skalierbarer und vernetzter werden und letztlich die Art und Weise verändern, wie wir Krankheiten verstehen und behandeln.