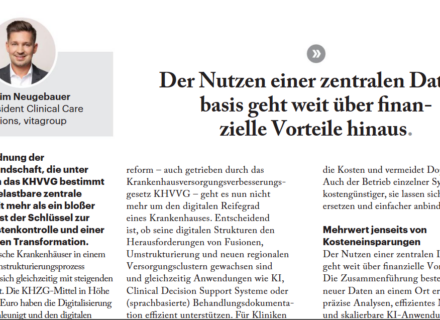Wie offene Plattformen Probleme der Systemintegration lösen
Das Gesundheitswesen steht vor großen Herausforderungen in puncto Integration – die meisten Systeme können keine Daten austauschen, was zu enormen Ineffizienzen und vermeidbaren Kosten führt. Offene Plattformen bieten hierfür eine Lösung dank herstellerneutraler, interoperabler Frameworks.

Die mangelnde Interoperabilität im Gesundheitswesen führt zu erheblichen Ineffizienzen und kostet die Branche jährlich über 150 Milliarden Euro¹. Und die Herausforderungen werden immer größer. Jüngste Untersuchungen zeigen, dass über 90 % der Organisationen mit dem Datenaustausch zu kämpfen haben. Jährlich verliert Klinikpersonal über 13 Millionen Arbeitsstunden, weil ihre Systeme nicht miteinander kommunizieren können. In nur einem Krankenhaus berichten Ärzte, dass sie „drei elektronische Patientenakten, mindestens vier webbasierte Anwendungen und zwei eigenständige interne Ergebnissysteme“ parallel nutzen müssen.
Hauptgrund dieser Probleme sind veraltete und monolithische IT-Systeme, die einen effizienten Datenaustausch erschweren. Diese Systeme bieten nur begrenzte API-Funktionen, eine uneinheitliche Anwendung von Datenstandards und komplexe Sicherheits- und Compliance-Anforderungen, was kostspielige und zeitaufwändige benutzerdefinierten Anpassungen zur Folge hat.
Gesundheitswesen mit offenen Plattformen vernetzen
Offene Plattformen gelten mit ihren herstellerunabhängigen Funktionen als wirksames Mittel gegen die Monopolstellung einzelner Anbieter. Durch die Bereitstellung standardisierter, flexibler und interoperabler Frameworks vereinfachen sie die Integration verschiedenster Systeme, Anwendungen und Datenquellen. „Offene Plattformen wie die HIP der vitagroup lösen Integrationsprobleme, da sie Herstellerunabhängigkeit gewährleisten und es Gesundheitsorganisationen ermöglichen, die volle Kontrolle über ihre Systeme und Daten zu erlangen“, sagt Markus Mann, Projektmanager bei der vitagroup.
Offene Plattformen wie die HIP der vitagroup lösen Integrationsprobleme (…) und ermöglichen es Gesundheitsorganisationen, die volle Kontrolle über ihre Systeme und Daten zu erlangen.
Markus Mann
Projektmanager, vitagroup

Diese Unabhängigkeit ist aus mehreren Gründen entscheidend:
- Vermeidung von Herstellerabhängigkeit: Geschlossene Systeme binden Organisationen oft an bestimmte Anbieter, was die Flexibilität einschränkt und die langfristigen Kosten in die Höhe treibt. Offene Plattformen lösen diese Abhängigkeit, indem sie es Organisationen ermöglichen, Lösungen verschiedener Anbieter zu wählen oder zu wechseln, ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen.
- Datenhoheit: Mittels offener Plattformen behalten Gesundheitsdienstleister die volle Kontrolle über ihre Daten. Dadurch wird die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen (z. B. der DSGVO) sichergestellt und die Abhängigkeit von proprietären Systemen, die den Zugriff einschränken und/oder die für Integrationen Gebühren erheben, verringert.
- Freiraum für Innovation: Anbieterunabhängige Plattformen ermöglichen es Organisationen, durch die Integration einer Vielzahl von Tools und Anwendungen innovativ zu agieren und ein Ökosystem verschiedener Lösungen zu etablieren, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
- Kostengünstige Skalierbarkeit: Organisationen können ihre Infrastruktur und Kapazitäten ohne zusätzliche Lizenzgebühren oder Einschränkungen durch den Anbieter erweitern, was zu einer höheren finanziellen und betrieblichen Effizienz führt.
- Nachhaltige Planbarkeit: Offene Plattformen wachsen und passen sich an technologische Fortschritte an. Das ermöglicht Gesundheitsdienstleistern, stets an der Spitze der Innovation zu bleiben, ohne durch die Roadmap eines einzelnen Anbieters eingeschränkt zu werden.
„Durch die Förderung von Interoperabilität, Flexibilität und Entscheidungsfreiheit bieten offene Plattformen die zukunftssichere Basis für die Vernetzung im Gesundheitswesen, bei der die Bedürfnisse von Dienstleistern, Patienten und Regulierungsbehörden Vorrang vor denen proprietärer Technologieanbieter haben“, sagt Markus Mann. „Diese Anbieterunabhängigkeit ist ein Grundpfeiler für den Aufbau widerstandsfähiger und innovativer Ökosysteme im Gesundheitswesen.“

Anbieterunabhängigkeit ist ein Grundpfeiler für den Aufbau widerstandsfähiger und innovativer Ökosysteme im Gesundheitswesen.
Markus Mann
Projektmanager, vitagroup
Bewältigung von Integrationsherausforderungen in Katalonien
Die offenen Standards, die API-gesteuerte Architektur und die strukturierte Verwaltung der Plattform der vitagroup ermöglichten eine erfolgreiche Integration in mehr als 1.000 Gesundheitseinrichtungen Kataloniens. Das Projekt stellt die bisher größte Implementierung einer offenen Plattform dar, die über 13 Millionen elektronische Gesundheitsakten und mehr als eine Milliarde Kompositionen verwaltet. Im engen Schulterschluss mit Partnern wie IBM, Yugabyte, Medblocks und Kyndryl konnten wir erhebliche technische Herausforderungen bewältigen und dieses umfangreiche System erfolgreich in Betrieb nehmen. Der enorme Umfang der Implementierungen führte zu mehreren kritischen Integrationsherausforderungen, die angegangen werden mussten, um Effizienz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, führte die vitagroup mehrere gezielte Strategien ein, die darauf abzielten, die Leistung der offenen Plattform zu optimieren, die Zuverlässigkeit zu gewährleisten und die Interoperabilität zu verbessern.
1. Leistungsoptimierung
Das Team optimierte die Abfrageausführungs-Engine und die Indexierungsstrategie, um eine effiziente Handhabung komplexer und hochvolumiger Abfragen zu gewährleisten. Wie Markus Mann anmerkt, „waren Lasttests mit Szenarien aus der realen Welt entscheidend, um Engpässe zu erkennen und maßgeschneiderte Lösungen zu implementieren – dabei haben wir uns gezielt an konkreten Use-Cases aus dem klinischen Alltag orientiert.“
2. Hochverfügbare Infrastruktur
Die Plattform der vitagroup nutzte eine Cloud-basierte Architektur und Redundanzmechanismen, um eine nahtlose Ausfallsicherung und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Technologien wie YugabyteDB wurden integriert, um die Zuverlässigkeit der Datenbank zu erhöhen.
3. Interoperabilitätsframeworks
Neben Leistung und Zuverlässigkeit spielte die Interoperabilität eine entscheidende Rolle für den Erfolg des Projekts. APIs und offene Standards waren entscheidend für einen reibungslosen Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen:
- Standards: Durch die Verwendung offener Standards wie openEHR und FHIR stellt die Plattform die Datenkompatibilität zwischen verschiedenen Systemen sicher.
- APIs: RESTful APIs erleichtern den Datenaustausch, ermöglichen Echtzeit-Interoperabilität und verringern die Abhängigkeit von proprietären Konnektoren.
- SMART on openEHR: Neue Standards wie SMART on openEHR vereinfachen die Authentifizierungs- und Autorisierungsprozesse für integrierte Anwendungen in Zukunft weiter.
4. Datenstandardisierung
Schließlich war die Aufrechterhaltung der Konsistenz der Daten über die verschiedenen Systeme hinweg ein entscheidender Aspekt der Implementierung. Die Plattform gewährleistet standardisierte Datenstrukturen durch:
- Standardisierte klinische Modelle unter Verwendung von Archetypen und Vorlage.
- Zentralisierte Steuerung für die Verwaltung von Archetypen
- Umfassende Schulungen und Community-Unterstützung für Anbieter
Die größten Herausforderungen betrafen drei zentrale Bereiche:
- Leistungsengpässe: Die schiere Datenmenge mit über 13 Millionen elektronischen Gesundheitsakten und mehr als einer Milliarde Zusammensetzungen führte zu erheblichen Verzögerungen bei patientenbezogenen Abfragen.
- Hohe Verfügbarkeitsanforderungen: Die verstreute Speicherung von Gesundheitsdaten in Katalonien erforderte eine robuste Hochverfügbarkeitsinfrastruktur (HA).
- Komplexität der Datenmigration: Der umfangreiche Datenmigrationsprozess stellte eine weitere zentrale Herausforderung dar.
Durch eine Kombination aus technischen Innovationen und strukturierter Verwaltung hat die HIP ihre Fähigkeit unter Beweis gestellt, die komplexen Integrationsherausforderungen großer Gesundheitssysteme zu bewältigen und dabei hohe Leistungs-, Zuverlässigkeits- und Interoperabilitätsstandards aufrechtzuerhalten.
Wertvolle Erkenntnisse
Die Einführung der Health Intelligence Platform in Katalonien hat wertvolle Erkenntnisse für groß angelegte Projekte zur Vernetzung des Gesundheitswesens geliefert. Markus Mann betont die Bedeutung von „Leistungstestumgebungen, die die Produktionsumgebung möglichst genau widerspiegeln – sowohl in Bezug auf die Infrastruktur als auch auf das Datenvolumen und die Datenverteilung“. Diese seien für groß angelegte Lösungen wie diese absolut unerlässlich.
Das Projekt hat auch die entscheidende Rolle der Einbindung von Interessengruppen verdeutlicht. Wie Markus Mann betont: „Eine der wichtigsten Lektionen ist die Notwendigkeit, alle Parteien regelmäßig zusammenzubringen. Regelmäßige Treffen mit Interessengruppen, darunter Gesundheitsdienstleister, Aufsichtsbehörden und IT-Teams, fördern die Transparenz, sorgen für eine gemeinsame Ausrichtung und ermöglichen eine Problemlösung in Echtzeit.“
Der Erfolg der Umsetzung wurde durch einen anwendungsfallorientierten Ansatz gefördert, der sowohl auf unmittelbare Betriebsanforderungen wie auch auf zukünftige Skalierbarkeitsanforderungen ausgerichtet war. Dieser Ansatz hilft allen Beteiligten, sich die langfristigen Vorteile vor Augen zu führen und ihre strategischen Ziele mit dem Projekt in Einklang zu bringen.
1 Europäische Kommission – Bericht über die Interoperabilität im Gesundheitswesen; European Observatory on Health Systems – Ineffizienzen im Gesundheitswesen; McKinsey & Company – Ineffizienzen im europäischen Gesundheitswesen; European Health Information Initiative (EHII) – Patient Safety Report; European Research Area (ERA) – Research Data Sharing and Duplication; European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) – Pandemic Response Analysis